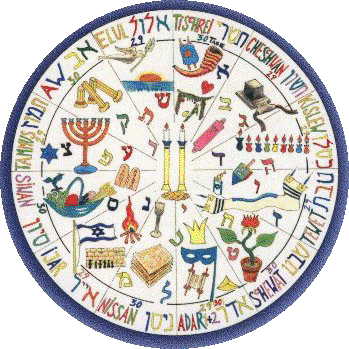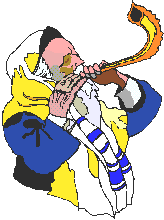 |
Rosh haSchanah und Jom Kippur Rosh haSchanah (jüdisches Neujahr)
Rosh haSchanah (das Jahr 5768) beginnt am Abend des 12.09.2007
und Jom Kippur bei Sonnenuntergang am 21.09.2007) Rosh haSchanah (das Jahr 5769) beginnt am Abend des 29.08.2008 und Jom Kippur bei Sonnenuntergang am 08.10.2009) Rosh haSchanah (das Jahr 5770) beginnt am Abend des 18.09.2009 und Jom Kippur bei Sonnenuntergang am 27.09.2009) LeShanah towah tikhathewu
vetihathmu! |
Rosch Ha-Schana ist der 1. Tischri (später September/früher Oktober), der erste Tag des jüdischen Jahres, der Tag der Weltschöpfung ("Im Anfang erschuf Gott die Himmel und die Erde.") nach der Mischna (zentrales Werk der jüd. mündl. Überlieferung). Ab diesem Tag beginnt die Berechnung von Kalenderjahren. Da der jüdische Kalender mit Mondmonaten von 29 bis 30 Tagen rechnet und alle paar Jahre einen Schaltmonat einfügt, wechselt das genaue Datum nach westlichem Kalender von Jahr zu Jahr (siehe nähere Erläuterung zum Zeitpunkt weiter unten). Rosch Ha-Schana wird von orthodoxen und konservativen Juden überall - auch in Israel - zwei Tage lang gehalten; viele Reformjuden halten Rosch Ha-Schana nur einen Tag lang. Rosch Ha-Schana wird in der Thora und im Gebetbuch "Tag des Gedenkens" (Jom Ha-Sikaron) und "Tag des Posaunenhalls" (Jom Teruah) genannt. Mit diesem Tag beginnt die zehntägige Periode der Selbstbesinnung und Reue (auch die zehn "Furchtbaren Tage", hebr. "Yamim Noraim" genannt, auch die zehn "Erhabenen Tage"), die im Jom Kippur, dem Versöhnungstag, den Höhepunkt haben.
"Hier und im Kiddusch wird das Fest
als Jom Hasikarom, als Tag des Gedenkens, geheiligt. Es ist das Gedenken
im äußersten Sinn, die Besinnung auf Gott und uns selbst, die große
Rechenschaft, die an diesem Abend beginnt. Rosch Ha-Schana heißt wörtlich
"Haupt des Jahres"; am Rosch Ha-Schana ist die Welt erschaffen
worden und jedes Jahr wird sie in den Menschen wiedererschaffen, indem
ihre Seelen in Umkehr und Rechenschaft, in Gericht und Gnade sich erneuern.
Man trägt nichts Buntes an diesen Tagen, und im Gotteshaus herrscht
die weiße Farbe vor. Der Vorhang der Lade ist weiß, meist mit goldenen
Buchstaben bestickt, die Decken auf Pult und Kanzel sind weiß, und weiß
ist der Kittel des Vorbeters, das Sterbekleid, das er schon am Rosch
Ha-Schana trägt. In allen Dingen kommt die Macht und Größe dieser Tage
zum Ausdruck. Während man sonst die Schmone Esre [Amida] kaum zu flüstern
wagt, weil, wie es in der Kabbala heißt, sonst nur die gebetsempfangenden
Engel sie hören dürfen, spricht man sie am Rosch Ha-Schana fast laut
und dringlich, wie wenn nun nichts Fremdes sie hören und stören, jeder
Laut und Gedanke sie und ihre Bitten nur mitbeten und verstärken könnte.
[Hirsch, S. 148]
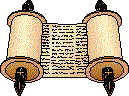 |
Der Neujahrswunsch "Guter Rutsch!" ist eine deutschsprachige Verballhornung und hat mit Rutschen nichts zu tun. Aus dem jiddischen Gruß "Gut Rosch" (Rosch = Kopf, Anfang; also etwa: "Gutes Neujahr") wurde schließlich der deutsche Neujahrswunsch "Guter Rutsch". |
Religiöse
Bräuche
"Im siebenten Monat, am ersten
Monatstag sei für euch ein besonders feierlicher Ruhetag, mahnendes Hörnerblasen
und heilige Versammlung. Da dürft ihr keinerlei Sklavenarbeit tun und
müßt dem Herrn ein Feueropfer darbringen." [Leviticus
23, 24 - 25]
 |
Rosch ha-Schanah und Jom Kippur sind durch das Blasen des Schofars gekennzeichnet. Ein Schofar ist ein Blasinstrument aus Widderhorn, das bei aschkenasischen Juden kein Mundstück hat, bei sephardischen Juden jedoch mit einem einfachen Mundstück ausgestattet ist. Am Nachmittag des ersten Tages gibt es den Brauch, Sünden symbolisch durch Werfen von Steinen oder Brotkrumen ins Wasser abzustreifen. Rund um das jüdische Neujahrsfest gibt es eine Reihe von Sitten. So ist es in einem orthodoxen jüdischen Haushalt beispielsweise üblich, an diesem Tag eine Frucht der neuen Saison zu servieren, die von keinem Familienmitglied bis dahin gegessen wurde. In der Thora wird dieser Tag auch Tag des Schofars genannt. |
|
"Weihe, Glück,
Ehrfurcht, Furcht und Hingabe an das Überwältigende, dies alles
enthält die Rosch Ha-Schana-Stimmung; wie 'um das Glück nicht
zu verschlafen' und zugleich auch, um selbst im Traum keine Sünde
zu begehen, bleiben viele Fromme die erste Nacht des neuen Jahres
wach. Am Morgen aber beginnt ein Gottesdienst von solcher Wucht
und Fülle der Gebete, von solcher Großartigkeit und Vielgestalt
religiöser Vorstellungen, wie er nur den Tagen äußerster Not und
Selbsteinsetzung vorbehalten sein kann, und den Höhepunkt bildet
das Schofarblasen." |
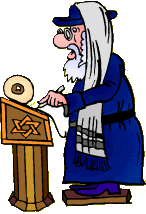 |
 |
Speisen Statthalter Nehemia ordnete in der Vergangenheit an: "Geht hin und eßt fette Speisen und trinkt süße Getränke und schickt denen Anteile, für die nichts zubereitet ist; denn dieser Tag ist unserem Herrn geweiht. Werdet darum nicht traurig; denn die Freude am Herrn ist euer Hort." [Nehemia 8, 9 - 10] |
Die Mahlzeiten an Rosch ha-Schana enthalten oft Früchte und Honig, um ein "süßes neues Jahr" zu symbolisieren. Daher darf auf dem Tisch auch ein Schüsselchen mit Honig nicht fehlen, da an diesem Abend die Challa nicht wie üblich in Salz getaucht wird. Nach dem Genuß der Challa taucht man auch ein Stückchen süßen Apfel in den Honig und betet dabei um ein gutes und süßes Jahr. Die beliebteste Nachspeise sind am Neujahrsfest Honigkuchen. [Lekach]
Oft wird auch eine süße Speise aus Möhren, Zimmes, gereicht, unter anderem auch deshalb weil Möhren auf jiddisch Meren heißen, was auch wachsen, zunehmen (mehren) bedeutet. So versinnbildlichen die Zimmes den Wunsch, unsere Vorzüge und Verdienste mögen im kommenden Jahr unsere Mängel überwiegen.
Von Sünden hat man sich beharrlich fernzuhalten, deshalb ißt man zu Neujahr keine Nüsse. Das hebräische Wort für Nuß, Egos, hat nämlich denselben numerischen Wert wie das Wort Chet, Sünde." [Dolezalová, S. 62]
Rosch ha-Schana beginnt im Herbst, am Tagesende zwischen dem 29. Tag des jüdischen Monats Elul. Das Fest dauert zwei Tage bis zum Tagesende des zweiten Tages des Monats Tischri (sogar in Israel, wo ansonsten die meisten Feiertage nur einen Tag lang sind). Der zweite Tag wurde später hinzugefügt. Es gibt Hinweise darauf, dass Rosch ha-Schanah bis ins 13. Jahrhundert in Jerusalem nur einen Tag lang gefeiert wurde. Das Reformjudentum, der liberalste Teil des Judentums, feiert generell nur den ersten Tag des Festes. Orthodoxes und konservatives Judentum beachten sowohl den ersten wie den zweiten Tag. Rosch ha-Schana findet 162 Tage nach dem ersten Tag des Pessachfestes statt. Unter dem derzeit gültigen gregorianischen Kalender kann das jüdische Neujahrsfest nicht vor dem 5. September stattfinden, wie z. B. in den Jahren 1899 und wieder 2013. Nach dem Jahr 2089 werden die Differenzen zwischen jüdischem Kalender und dem Gregorianischen Kalender dazu führen, daß Rosch ha-Schana nicht vor dem 6. September liegen kann. Das Fest kann nicht später als am 5. Oktober liegen, wie z. B. im Jahr 1967 und wieder im Jahr 2043. Der jüdische Kalender ist so aufgebaut, daß der erste Tag von Rosch ha-Schanah niemals auf einen Mittwoch, Freitag oder Sonntag fällt.
Jom
Kippur (Versöhnungsfest)
(2005: beginnt am Abend des 12.10.
und endet bei Sonnenuntergang am 13.10.)
Jom Kippur ist der jüdische Versöhnungstag
und gleichzeitig der wichtigste und heiligste Festtag im Judentum. Im
jüdischen Kalender beginnt der Versöhnungstag bei Sonnenuntergang vor
dem 10. Tischri (d.h. September/Oktober), und dauert bis zum nächsten
Sonnenuntergang. Der Versönungstag ist der Abschluss der zehn Tage
der Reue und Umkehr, die am Neujahrstag Rosh ha-Schanah begannen. Zwar
ist reuevolles Gebet zu allen Zeiten möglich, gilt aber an diesem
Tag als besonders wirkungsvoll. Im Gegensatz zur vorherrschenden Meinung
ist Jom Kippur kein trauriger Tag. Sephardische Juden bezeichnen diesen
Festtag als "weißen Fasttag". Viele Juden pflegen sich an diesem
Tag weiß zu kleiden, als Symbol der Reinheit von Sünden.
| Der Tag vor Jom Kippur "Erew Jom Kippur" (Erew heißt Abend), der Vortag des Versöhnungsfestes, ist beinahe selbst ein Fest. Man darf an diesem Tage nicht fasten, und selbst wer ein Gelübde getan hat, nicht einmal an einem Feiertag Fleisch zu essen, soll es am Erew Jom Kippur dennoch ignorieren. Man spricht kein Tachanun [Bußgebet] am Morgen, man ißt kein Ei, man vermeidet jedes Zeichen von Trauer, man bereitet sich wie zu einer äußersten Entscheidung. Man bringt eine Art Sühnopfer (Kappara): Ein lebendiges Huhn, das man sich dreimal ums Haupt schwingt, soll gleichsam die menschliche Schuld übernehmen. Nach der Zeremonie wird das Tier geschlachtet. Dieser Brauch (kein Gebot!) wird in den Schriften des Geonim nicht im Talmud erwähnt und nur von europäischen und amerikanischen, nicht aber von afrikanischen und asiatischen Juden ausgeübt. | 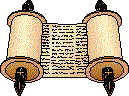 |
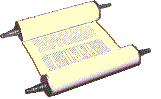 |
Der zehnte Tag desselben siebenten Monats ist jedoch der Versöhnungstag; da ist heilige Versammlung für euch; ihr sollt euch fastend kasteien und dem Herrn ein Feueropfer darbringen. An diesem Tag sollt ihr keinerlei Arbeit verrichten, denn der Versöhnungstag soll euch vor dem Herrn, eurem Gotte, Sühne schaffen. Wer immer an eben diesem Tage nicht fastet, soll aus seinem Volk ausgetilgt werden. Jeden, der an diesem Tage irgendeine Arbeit verrichtet, werde ich mitten aus seinem Volk hinwegraffen. Keine Arbeit dürft ihr verrichten! Das ist eine immerwährende Satzung für all eure Geschlechter in all euren Wohnstätten. Ein Sabbat, ein heiliger Ruhetag soll es für euch sein, ihr sollt euch fastend kasteien. Am neunten des Monats -- von diesem Abend bis zum folgenden -- sollt ihr euren Ruhetag beobachten. [Leviticus 23, 27 - 32] |
Vorschriften für Jom Kippur
Am Jom Kippur, an dem einst der
Sündenbock ausgesendet wurde und im Allerheiligsten der Hohepriester
den großen Opferdienst verrichtete, am Jom Kippur, der im Talmud oft
geradezu 'Der Tag' genannt wird als der Gipfel und die Vollendung
der Seelenerneuerung, als der Tag des Sündenbekenntnisses und der
Läuterung als 'das Herz des Jahres' und als 'der Schabbat aller Schabbatot',
an diesem Tage sind alle Schabbatvorschriften in Kraft und dazu noch
' von Abend zu Abend' die folgenden:
Jeder Jude, Mann oder Frau, Knaben vom zwölften, Mädchen vom elften Jahre an, mit Ausnahme von Schwerkranken und Wöchnerinnen,
-
darf weder Speise noch Trank zu sich nehmen (komplettes Fasten!)
-
darf kein Leder tragen, auch weder Lederschuhe noch Stiefel anziehen
-
sich weder baden noch waschen, sondern nur die Finger und die Augen netzen
-
sich weder mit Öl noch wohlriechendem Wasser und dergleichen einreiben
-
und sich auch sonst keinen Genuß gönnen
- keine sexuellen Beziehungen
Religiöse Bedeutung der Gebete
Das Ritual des Festes wird zum größten
Teil in der Synagoge vollzogen. An diesem Tag dauert der Gottesdienst
ohne Unterbrechung vom Aufbruch des Tages bis zum Aufgang der Sterne.
Fastend, unbeschuht, im Totenkleid betet man den ganzen Tag. Der Gottesdienst
beginnt mit dem Gebet "Kol Nidre", das vor Sonnenuntergang gelesen
wird. Kol Nidre, aramäisch für "Alle Gelübde",
ist eine öffentliche Aufhebung aller Gelübde, die im folgenden
Jahr eingegangen werden. Die deutsche Übersetzung dieses Gebets
lautet: "Alle Gelübde, Verbote, Bannsprüche, Umschreibungen
und Nebenbezeichnungen derselben, Strafen und Schwüre, die wir
geloben, schwören, als Bann aussprechen, uns als Verbot auferlegen
von diesem Versöhnungstage bis zum Glück bringenden nächsten
Versöhnungstag: alle bereue ich, alle seien aufgelöst." Nach
jüdischer Tradition betrifft dies ausschließlich Verpflichtungen
oder Entsagungen, welche die Person des Gelobenden betreffen, nicht
aber Versprechen, die einem Nebenmenschen gegenüber eingegangen
werden.
Das Morgengebet enthält zahlreiche Litaneien und Bitten um Vergebung,
die auf hebräisch Selichot genannt werden.
Gemäß Maimonides "hängt alles davon ab, ob die Verdienste
eines Menschen die von ihm begangenen Fehler überwiegen". Nach
der jüdischen Lehre ist der Tag nutzlos, solange er nicht von Reue
begleitet ist. Das reuevolle Eingeständnis von Sünden war
eine Bedingung zur Sühne. "Der Versöhnungstag befreit von
Sünden gegen Gott, jedoch von Sünden gegen den Nächsten
erst, nachdem die geschädigte Person um Verzeihung gebeten worden
ist" [Talmud Joma VIII, 9] Deshalb sind
zahlreiche gute Taten vor dem Urteil am Versöhnungstag angebracht.
Denn das Urteil (Jahwes Urteil) ist bislang noch nicht besiegelt. Wer
von Gott als wertvoll erachtet wird, wird ins Buch des Lebens eingeschrieben,
und so wird im Gebet gesagt: "Schreibe uns ins Buch des Lebens ein".
Auch begrüßt man sich mit den Worten: "Mögest du (im
Buch des Lebens) für ein glückliches Jahr eingeschrieben werden."
Auch nach der Zerstörung des zweiten Tempels im Jahre 70 u.Z. wurde
der Versöhnungstag beibehalten. "Auch ohne dargebrachte Opfer bewirkt
der Tag an sich Versöhnung" [Midrasch Sifra,
Emor, XIV]. . Am Versöhnungstag erhalten auch die Seelen
der Toten Vergebung. Im Gebet Jiskor wird in der Synagoge der
Verstorbenen gedacht.
Zum Schluß bläst der Schofarbläser einen einzigen langgezogenen
Ton (Tekia Gedola). Jom Kippur ist zu Ende. Man spricht nur noch kurz
ein werktägliches Abendgebet, legt den Tallit zusammen und zieht Totenkittel
aus. Man begrüßt einander mit dem Wunsch: “Gut Jahr“ und geht anschließend
eilig und hungrig nach Hause. Allerdings gehört es zu den Mizwot (Geboten),
noch am Abend die ersten Vorbereitungen zum Bau des Sukka, der Laubhütte,
für das wenige Tage spätere Freudenfest zu treffen.
Der Sündenbock
.
|
Gott ließ mich das Allerheiligste seines Tempels betreten, aber auch dort kam ich nicht zur Ruhe, denn es kam der Feind und brachte mich ins Exil, weil ich anderen Göttern gedient hatte. Er mischte mir vergifteten Wein Die Griechen rotteten sich
gegen mich zusammen, damals zur Zeit der Hasmonäer. Sie durchbrachen
die Mauern meiner Türme, sie verunreinigten fast alles Öl. Seder hat-tefillôt, I, S. 201 |
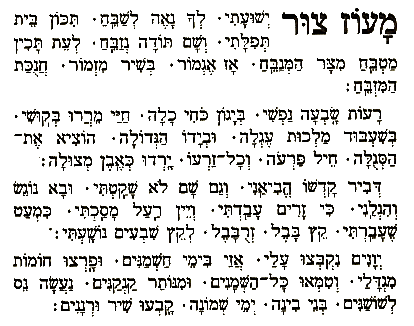 |
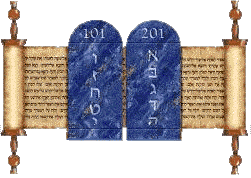
Quellen:
www.payer.de
mündliche Überlieferungen,
eigene Erfahrungen (Anita S. Selig, Zaddik-Linie)
Thora (= Altes Testament)
www.wikipedia.de
www.hagalil.de